Michael Römling
09.2025 Histo-Couch Redakteur Carsten Jaehner im Gespräch mit Michael Römling über Die Stadt der Auserwählten und die Geschichte von Münster.

Leider sind die Siege der Vernunft offenbar immer nur vorübergehend.
Histo-Couch: Sehr geehrter Herr Römling, Ihr Roman „Die Stadt der Auserwählten“ erzählt vom Wiedertäuferreich in den Jahren 1534/35 in Münster. Ist Ihnen das Thema bereits innerhalb Ihrer Buchreihe über die Stadtgeschichte einiger deutschen Städte, u. a. über Münster aus dem Jahr 2006, aufgefallen?
Michael Römling: Ja. Das ist ja eine ganz außergewöhnliche Episode in der Geschichte von Münster, der ich damals ein ziemlich langes Kapitel gewidmet habe. Die Reformation verläuft bei den deutschen Städten in den ersten dreißig Jahren nach Luthers Thesenanschlag ja häufig nach einem vergleichbaren Raster ab: Auftritt charismatischer Prediger, Verbindung theologischer mit politischen Forderungen, Lagerbildung in Überschneidung mit sozialen Gruppen, tumultartige Ausschreitungen, Eingreifen des Landesherrn für oder gegen die Neuerungen. Am Ende – jedenfalls bis zu den gewaltsam errungenen Erfolgen der Gegenreformation – sind diese Städte dann meistens mehrheitlich oder vollständig evangelisch. Auch Münster ist diesen Weg gegangen. Aber dann lief plötzlich alles aus dem Ruder, und es entstand eine Theokratie von unvorstellbarer Radikalität. Ich dachte damals noch nicht ans Romaneschreiben, sonst wäre mir das wahrscheinlich gleich als Stoff ins Auge gesprungen.
Histo-Couch: Was meinen Sie, warum war gerade Münster „auserwählt“? Was machte die Stadt so „anfällig“ für das Wiedertäufertum?
Michael Römling: Dafür sind im Wesentlichen drei Faktoren verantwortlich, und wenn nur einer davon ausgefallen wäre, hätte es kein Täuferreich von Münster gegeben. Erstens neigte der theologische Kopf der reformatorischen Bewegung in Münster, Bernhard Rothmann, dem radikalen Täufertum zu, während solche Leute in anderen Städten meistens lutherisch gesinnt waren. Rothmann hatte auch als Lutheraner angefangen, war da aber eben nicht stehen geblieben und hatte Gleichgesinnte nachgeholt. Und weil er ein begabter Prediger war, sind ihm viele Bürger auf seinem Weg der Radikalisierung auch dann gefolgt, als er mit der öffentlichen Verwerfung der Kindertaufe aus der Sicht der lutherischen Orthodoxie endgültig falsch abgebogen war. Zweitens gab es in der Stadt einen starken Widerstand gegen die Bestrebungen des Bischofs, sich die Stadt wieder gefügig zu machen. Die Münsteraner mochten in Glaubensfragen zerstritten sein, aber die gegenseitige Duldung erschien den konfessionellen Lagern gegenüber der drohenden Bevormundung durch Franz von Waldeck das kleinere Übel. Die Stadt, in deren Rat die Lutheraner die Mehrheit hatten, stand im Januar 1534 am Rand eines Bürgerkrieges: Die Täufer verdächtigten Lutheraner und Katholiken, bischöfliche Truppen in die Stadt schleusen zu wollen; Katholiken und Lutheraner verdächtigten die Täufer, einen Putsch zu planen. Der Rat war zu zaghaft, um durchzugreifen. In dieser aufgeladenen Situation wurde das Täufertum im so genannten Toleranzrezess legalisiert, um den Druck vom Kessel zu nehmen und Einigkeit gegen den Bischof herzustellen. Die Täufer waren damals noch in der Minderheit, und der Rat glaubte, sie unter Kontrolle halten zu können. In Wahrheit aber hatte er mit dieser Legalisierung den Rubikon überschritten. Denn jetzt kommt der dritte Faktor ins Spiel: Durch den Toleranzrezess – der einzige Fall einer Legalisierung der täuferischen Betätigung überhaupt – wurde Münster zum Sehnsuchtsort aller Täufer in der weiteren Region, vor allem in den Niederlanden, wo sie sich unter der spirituellen Führung von Jan Matthys schon sehr weit in ihre apokalyptische Hysterie hineingesteigert hatten und glaubten, die freie Religionsausübung der Täufer in Münster sei ein Fingerzeig auf das himmlische Jerusalem, also machten sie sich zu Tausenden völlig kopflos auf den Weg. In der Stadt hatte derweil ein atemberaubender Prozess der Machtübernahme durch die Täufer eingesetzt. Bei der Ratswahl einen Monat nach dem Toleranzrezess setzten sich die Unterstützer und Sympathisanten der Täufer durch, gleichzeitig erschien Jan Matthys persönlich in Münster und predigte die Reinigung der Gemeinde von allen Ungläubigen und Zauderern. Nur eine Woche später wurden alle, die die Taufe verweigerten, aus der Stadt getrieben. Es verschwanden also gleichzeitig die Gegner der Täufer, während ihre Unterstützer in Massen hereinströmten. Ab da war der Weg in die Theokratie frei.
Um es zusammenzufassen: Münster war nicht prädestiniert dafür, die Stadt der Auserwählten zu werden. Hier trafen nur die falschen Leute zur falschen Zeit zusammen und setzten unter Ausnutzung der politischen Konstellation einen Mechanismus der Machtübernahme in Gang, der unter ähnlichen Konstellationen auch anderswo funktioniert hätte.
Histo-Couch: Die Hauptfigur Jakob kommt aus den Niederlanden nach Münster, um ein Mädchen zu finden. Wie sind Sie darauf gekommen, Ihre Geschichte „von außen nach innen“ zu erzählen?
Michael Römling: Weil ich den Roman nicht nur in diesem selbstgenügsamen und beschaulichen Milieu verwurzeln wollte, das den Täufern auf den Leim geht. Ich kann die Täufer zu verstehen versuchen, so wie ich Nazis und Dschihadisten zu verstehen versuchen kann, aber ich will sie und ihre Sympathisanten nicht als Protagonisten durch ein ganzes Buch begleiten; das würde sich anfühlen, als müsste ich als Pazifist den Pressesprecher für einen Rüstungskonzern geben. Ich wollte also einen Protagonisten, der dieser Irrationalität und diesem Fanatismus von Anfang an distanziert bis angewidert gegenübersteht. Obwohl natürlich klar war, dass es ein Roman über die Täufer werden soll, habe ich zuerst nach einer solchen Figur gesucht und sie dann im Umfeld von Maria von Ungarn in Brüssel gefunden – übrigens auch so eine Persönlichkeit die mehr verdient hätte als eine Nebenrolle. Die Habsburger Familienpolitik kriegt ja dann, nebenher bemerkt und ohne zu viel verraten zu wollen, im weiteren Verlauf des Buches ohnehin nochmal eine gewisse Bedeutung.
Histo-Couch: An der Lambertikirche in Münster sieht man heute noch die drei Käfige, in denen die Leichname der drei Hauptverantwortlichen als abschreckendes Beispiel zur Schau gestellt wurden. Aus welchem Grund kommt der dritte im Bunde, Bernd Krechting, in Ihrem Roman nicht vor?
Michael Römling: Dessen Leiche wurde ja nicht in den dritten Käfig gesteckt, weil er der drittwichtigste Mann im Täuferreich war, sondern weil sie ihn erwischt haben. Eigentlich hätte Bernd Rothmann in den dritten Käfig gehört, aber den haben sie eben nicht zu fassen gekriegt; bis heute weiß kein Mensch, was aus dem geworden ist. In der Gesamtkonstellation des Plots habe ich Bernd Krechting einfach nicht gebraucht – eine blasse Figur, die keine Position besetzt, mit der man irgendetwas veranschaulichen könnte.
Histo-Couch: Gäbe es die Möglichkeit einer Zeitreise, wären Sie damals gerne dabei gewesen?
Michael Römling: Natürlich, man will ja alles mit eigenen Augen sehen. Man hat sich ein Bild von dieser Zeit gemacht und würde das gern mit der Wirklichkeit abgleichen. Aber wir verstehen uns hier hoffentlich schon richtig, dass ich das als Zuschauer erleben würde, nicht als Beteiligter? Oder dass ich mich spätestens dann zurückteleportieren lassen könnte, wenn sie meinen Kopf auf den Hauklotz legten? Ansonsten eher nicht, schönen Dank auch.
Histo-Couch: Wie steht es um die Quellenlage aus dieser Zeit?
Michael Römling: Mittelmäßig. Es gibt Prozessunterlagen, Pamphlete, Korrespondenz und theologische Schriften, Leute mit Sendungsbewusstsein sind ja sehr mitteilsam. Aber für die konkrete Situation in Münster in diesen sechzehn Monaten der Täuferherrschaft ist die Quellenlage weniger gut. Die meiste Beachtung haben eine Reihe von Augenzeugenberichten gefunden, die erst im Nachhinein entstanden sind, also nach der vollständigen Diskreditierung der Täufer, und deren Verfasser lassen natürlich kein gutes Haar an der Bewegung. Es war ein bisschen wie 1945: Keiner hat mitgemacht. Deshalb sind einige der dort berichteten Anekdoten mit Vorsicht zu genießen. Sicherlich gab es Szenen von befremdlicher Massenhysterie, aber ob die sich alle, wie bei Hermann von Kerssenbrock geschildert, haareraufend und unzusammenhängende Laute brabbelnd im Schlamm gewälzt haben, ist doch fraglich. Es wäre schön, wenn von den Unterlagen, die die Täufer selbst in Münster in dieser Zeit zum Alltagsleben produziert hätten, irgendetwas erhalten wäre. Leider gibt es da so gut wie gar nichts.
Histo-Couch: Die Geschichte entbehrt ja leider nicht einer gewissen Aktualität, was das blinde Vertrauen in die Führung von Politikern und religiösen Eiferern angeht. Was denken Sie, warum wiederholt sich die Geschichte immer wieder?
Michael Römling: Sie spielen wahrscheinlich auf die MAGA-Bewegung und deren Epigonen und Claquere in anderen Ländern an, leider auch bei uns. Das war abgesehen von Nazis und Dschihadisten auch eine Parallele, die sich mir schon beim Schreiben aufdrängte. Jetzt ist das Buch seit einem halben Jahr fertig, und sie wird immer offensichtlicher: dieser Drang, den Gegner niederzuwalzen und zu demütigen, der Vernichtungswille, die hämische Rachsucht, der Verschwörungsglaube, die Endkampfhysterie, der Erweckungsfanatismus, die Empörungslust, die Verdrehung der Wirklichkeit, das ungenierte und dummdreiste Lügen und die Bereitschaft, den Verstand auszuschalten und jeden Irrsinn zu glauben und nachzuplappern. Um es mit Max Liebermann zu sagen: Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Im Grunde ist 1534 in Münster etwas sehr Ähnliches passiert wie 1933 in Deutschland: Die Lautesten, Dreistesten, Aggressivsten und Gnadenlosesten gewinnen die Oberhand, die Unentschlossenen werden mitgerissen und die Besonnenen ziehen sich zurück. Ob wir so etwas in den nächsten Jahren in unserem Teil der Welt noch einmal erleben werden, will ich nicht hoffen, aber es scheint Kräfte zu geben, die ganz versessen darauf sind. Dass Geschichte sich wiederholt, würde ich übrigens auch nicht unterschreiben, schon weil dieser Annahme ein so unerträglicher Fatalismus innewohnt. Aber die Neigung von Menschen, aus Unsicherheit oder Bequemlichkeit in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, anstatt Grauzonen zu ertragen oder vielleicht sogar als Herausforderung und Anreiz zu konstruktivem Streit zu sehen – das ist eine Grundkonstante oder von mir aus eine immanente Gefahr, die allen Gesellschaften drohen kann. Leider sind die Siege der Vernunft offenbar immer nur vorübergehend.
Histo-Couch: Und eine Sache, die unser Leser/innen und ich gerne noch erfahren würden: Wird es einen weiteren Teil Ihrer „Tankred“-Reihe geben? Was planen Sie als nächstes?
Michael Römling: Tankred geht mit dem fünften Band zu Ende, auch wenn ich ihn manchmal ganz gerne wieder auferstehen lassen würde. Das Problem ist, dass die Dänen nach der Belagerung von Paris, die das Thema dieses letzten Bandes ist, erstmal Ruhe gegeben haben. Sechs Jahre später haben sie dann nochmal Prüm geplündert wie ganz zu Anfang des ersten Bandes, aber warum sollte man ein zweites Mal die Plünderung desselben Klosters schildern? Als Dänenschlächter hätte Tankred auf dem Kontinent nach 886 keine neuen Lorbeeren mehr gewinnen können. Derzeit schreibe ich an einer neuen Reihe (Berengar), die im 12. Jahrhundert spielt, mit viel Spannung und Action.
Das Interview führte Carsten Jaehner im September 2025.
Bild: © Privat



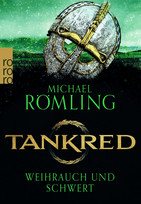

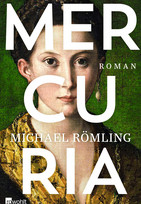
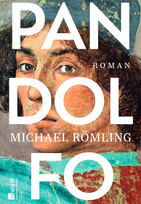
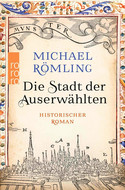

Neue Kommentare